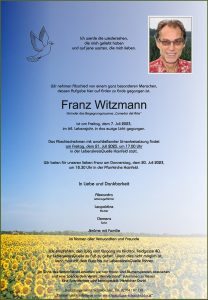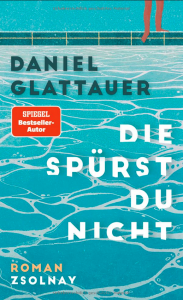Sorry, this entry is only available in Deutsch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
„Wer einen gut geschriebenen Roman lesen will, der durch die schiere Kraft der Idee, die dahinter steht, vorangetrieben wird, wird von Glattauer gut bedient. Wer als Leser, Leserin aber nachspüren will, was der Tod des Mädchens Aayna bei denen, die ihn erleben, verantworten, ertragen müssen, auslöst; oder wer annähernd spüren will, was Flucht in eine Gesellschaft bedeutet, die letztlich herzlich desinteressiert ist an den Opfern, die sie produziert, wird das Buch mit einem Gefühl der inneren Leere zuschlagen.“
Aus Cathrin Kahlweit: Daniel Glattauer “Die spürst du nicht”: Ende gut, gar nichts gut
Süddeutsche online 24.3.2023
Ich habe in der Süddeutschen-online eine Kritik des neuen Buches von Daniel Glattauer gelesen. Die oben zitierte Textstelle ermunterte mich, Widerspruch zu formulieren.
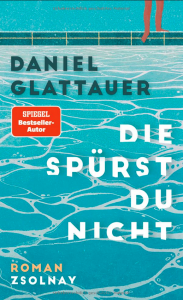
Cathrin Kahlweit meint in ihrer SZ-Buchrezension, dass jene, die zum Fluchthema ernsthaft hinspüren möchten „mit dem Gefühl einer inneren Leere“ zurückbleiben. Innere Leere? Der Ausdruck hat mich elektrisiert, weil ich nach der Lektüre von „Die spürst du nicht“ so voller Emotion war, also ganz das Gegenteil eines Gefühls von innerer Leere verspürte. Aber vielleicht hat der Autor bei mir einfach etwas geöffnet, alleine durch „die schiere Kraft der Idee, die dahinter steht“ (siehe Zitat oben). Ich meine also, es war für mich gar nicht nötig, die einzelnen Figuren und ihre Emotionen so genau auszuformulieren. Und ich frage mich, ob dieser Anspruch nicht überhaupt zu hoch gegriffen ist?
Obwohl ja, ich gebe es zu. Als ich das Buch am Ladentisch sah, hatte ich meine Vorbehalte. Ich war auch ein großer Fan von “Gut gegen Nordwind” gewesen und von den Nachfolgewerken etwas enttäuscht. Und überhaupt, die werbenden Keywords für das Buch ließen mich zweifeln. Bobofamilie trifft auf somalische Flüchtlinge. Ich kann damit nicht soviel anfangen. Ich kenne so viele Menschen in der Helfer:innenzene für geflüchtete Menschen, die so gar keine Bobos sind. Und überhaupt, diese dauernden Schubladisierungen nerven einfach. Da wir aber seit 2016 ein Haus in Hainfeld betreiben, wo sich „Hiesige und Zuagroaste“ treffen können und ich überdies in einem Flüchlingsquartier in der Nähe Deutsch unterrichte, dachte ich mir, das Buch ist für mich quasi eine Pflichtlektüre, also nimm es zur Hand!
Meine Skepsis schlug schon nach wenigen Seiten in Begeisterung um. Es brauchte nur einen Samstagabend und ein längeres Sonntagsfrühstück, bis ich bei den letzten Seiten angelangt war. Der spannende abschließende Dreh, dass zum Schluss die Geschichte der somalischen Familie erzählt wird, und zwar nicht nur den Protagonist:innen des Romans, sondern auch den Leser:innen, also mir, begeisterte mich. Das flotte Buch eines Erfolgsautors als ein Forum für ein Thema nützen, um das sich alle herumdrücken – Politiker:innen, aber auch Menschen, die man persönlich kennt. Und sicher nicht nur Bobos …
Ich habe das Buch zugeschlagen und begann sofort zu recherchieren. Über den Autor und dass er selbst somalische Jugendliche begleitet habe, und vor allem über Somalia selbst. Warum suche ich regelmäßig nach Nachrichten über die Ukraine, Afghanistan oder den Iran, ja sogar über Venezuela, denn auch aus Venezuela flüchten Menschen nach Österreich, warum aber noch nie über Somalia? Ich hatte etwas übersehen, und es war nicht nur ein Thema, sondern vor allem eine Gruppe Mitmenschen.
Das nächste Mal im Deutschkurs spürte ich, wie ich dem jungen Mann aus Somalia etwas näher war also sonst. Ein junger Mann mit einem hübschen Lockenkopf, der zwar etwas Englisch spricht, aber trotzdem so offensichtlich verloren und unglücklich wirkt. Ich war mütterlicher, liebevoller als davor. Es war, als hätte sich bei mir eine innere Blockade gelöst. Geschuldet war dieser Wandel meiner Wochenendlektüre.
Der Vorwurf der Leere
Noch ein paar Gedanken zum Vorwurf der Leere, den Cathrin Kahlweit in der SZ aufwirft. Ja, geht es nicht gerade um diese Leere? Ich finde nicht, dass die vom Autor eingebauten Kommentare aus Internetforen und Pressemitteilungen ablenken und nichts bringen. Im Gegenteil – so ist doch unsere Welt. Das ist ja das, was kaum auszuhalten ist. Wobei die Kommentare, die Daniel Glattauer erfindet, noch relativ erträglich sind gegen das, was das Netz in Wirklichkeit hergibt. Ist das Problem nicht gerade die Tatsache, dass dauernd Leute kommentieren, die nichts spüren, die leer sind, weil ihnen die Erfahrung, der direkte Kontakt zu den Geflüchteten fehlt? Sie reden über sie, aber nicht mit ihnen. Trotzdem lesen wir diese Äußerungen, diese hingepatzten Meinungen, als würden sie uns doch einen Strohhalm zum besseren Weltverständnis liefern können.
Aber auch helfende Menschen sind jenen, denen sie helfen möchten, nicht zwingend nah, die gute Absicht kann die Leere nicht immer auffüllen. Da wechseln sich Momente voll von Dankbarkeit mit Augenblicken, die Missverständnisse und Angestrengtheit signalisieren. Wir suchen nach Wörtern, die wir uns mühsam im Deutschkurs gemeinsam erarbeiten, um Brücken zu bauen – über die große Leere, die uns trennt. Scheinbar, weil wir unterschiedlichen Sprachen sprechen, aber auch weil unsere Geschichten und Emotionen einfach zu kompliziert sind.
Und was ist mit der Leere durch tragische Traumatisierungen bei den Betroffenen selbst? Erlebnisse, die verdrängt werden, weil man sonst einfach nicht weiterleben kann? Sich nicht zu spüren, was bedeutet das für Menschen mit einer Fluchtbiographie? Was bedeutet es zB für Ukrainerinnen, die hier bei uns versuchen ein normales Leben zu führen und mich tapfer anlächeln – was spüren sie in diesem Wahnsinn? Besser leer als zu viel Emotion? Manchmal ist das schlicht der einzige Weg durchzuhalten. Auch für mich.
Der Begriff Gutmensch
Cathrin Calweit schreibt in der SZ; „…. ; bisweilen scheint es fast, als wollte er die Sentenz von den “Gutmenschen” in ihrer ganzen Plattheit beweisen.“ Ehrlich, ich kann den Begriff Gutmenschen schon nicht mehr hören bzw. lesen, er hat etwas schleichend Abwertendes in sich, ist irgendwie toxisch. Für mich sind die Figuren auch nicht so platt, sie sind eher hilflos. Ich finde es auch irreführend, gerade diese Figuren als Gutmenschen zu bezeichnen. Sie sind doch eher zufällig in die Sachen hineingestolpert, durch die Tochter, die ihre Freundin in den Urlaub mitnehmen wollte. Na gut, die Mutter beschreibt Daniel Glattauer als Grünpolitikerin in Wien. Aber es könnte genausogut einem FPÖ-Funktionär auf dem Land passieren, dass sich seine Tochter mit einem gleichaltrigen Mädchen aus zB Afghanistan anfreundet. Kinder sind bekanntlich Integrationsweltmeister:innen und scheren sich glücklicherweise nicht zwingend um die Parteizugehörigkeit ihrer Eltern. Und auch die Figur des seltsamen Anwalts aus Kärnten, dessen Ansichten anfangs eher als migrationsfeindlich beschrieben werden, der dann aber durch Zufall mit der somalischen Familie in Kontakt kommt und sich für diese einsetzt, erzählt ja genau davon. Vom Zufall, der einen Gutes tun lässt und nicht von der Kraft einer verinnerlichten moralischen Überzeugung.
Daniel Glattauer arbeitet das Thema und die Figuren flott ab. Trotzdem gelingt es ihm, eine große Frage in den Raum zu stellen: Was passiert, wenn wir uns darauf einlassen, Menschen mit einer Fluchtbiographie, die überdies noch aus einem uns fremden Kulturkreis stammen, zu begleiten? Was passiert also, wenn wir uns engagieren wollen? Ich finde, alleine diese Frage zu stellen, ist wichtig. Denn dass es nicht einfach ist, möchte uns der Autor gar nicht erst vorgaukeln. Das darauffolgende Drama ist für den Roman offensichtlich nützlich, macht die Situation verzwickt und den Text erst so richtig spannend.
Das Leben braucht solche Dramen hoffentlich in den meisten Fällen nicht. Was mir also ein wenig fehlt, ist zu erzählen, dass sich Engagement trotzdem lohnt. Diese Geschichte sollte nicht abschreckend wirken, sondern ganz im Gegenteil Neugier wecken. Trotz der Ratlosigkeit, trotz des Gefühls des immer wieder Getrenntseins, trotz der vielen Missverständnisse. Es lohnt jeder Versuch, mehr über die Geschichten der Menschen zu erfahren oder – noch besser – mit ihnen in persönlichen Kontakt zu kommen. Um sie dann irgendwann vielleicht auch auf eine Woche Urlaub einzuladen. Mein Lebensgefährte und ich haben übrigens letzten Herbst einen jungen Mann aus Afghanistan auf eine Kurzreise nach Hamburg mitgenommen. Wir hatten viel Spaß zusammen. Ganz ohne Drama.
Daniel Glattauer nützt seine Popularität, um auf ein unpopuläres Thema hinzuweisen. Alleine dafür gebührt ihm in Zeiten wie diesen Respekt.